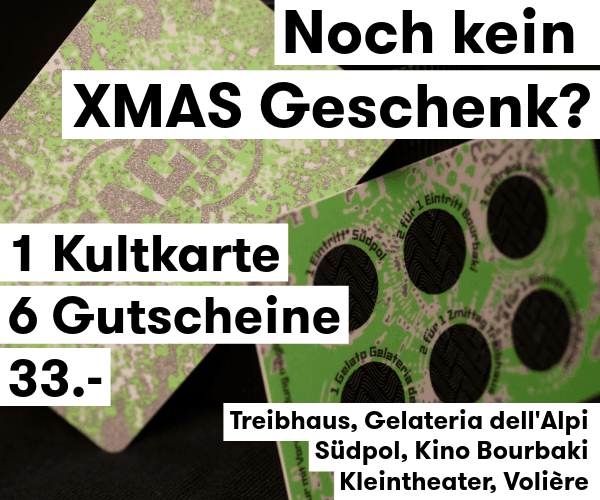28.06.25
Schwimmen auf Tribschen
Anfang April eröffnete die neue Ausstellung im Richard Wagner Museum. Wagt sie den Sprung aus der Idylle?
Giulia Bernardi (Text)
Wer die letzte Ausstellung im Richard Wagner Museum gesehen hat, mag von der aktuellen erstmal überrascht sein. Während zuvor die historische Atmosphäre, in der Wagner auf Tribschen gelebt und gewirkt hat, im Mittelpunkt stand, widmet sich die aktuelle Ausstellung einer verantwortungsvolleren Kontextualisierung.
Die Sonderausstellung im oberen Stock begnügt sich nicht mehr mit der Vermittlung der aufwändigen Restaurierungsarbeiten – welche Farbe gewählt, welche Tapete verwendet wurde, um die Räumlichkeiten möglichst authentisch wirken zu lassen. Im Gegenteil: Nun sollen die Bruchlinien aufgezeigt werden, die sich durch diesen Ort ziehen, durch «Wagners Idyll», wie er letztes Jahr auf Plakaten angepriesen wurde.
Antisemitismus als Ausgangspunkt
Unter dem Titel «Tabu Wagner? Jüdische Perspektiven» soll Wagners Antisemitismus im Fokus stehen und aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden. «Wie wirkte und wirkt Wagner auf Jüd:innen?», lautet die Leitfrage, die anhand der Aussagen von 29 Persönlichkeiten erörtert wird. Die mehrheitlich männlichen Komponist:innen, Opernsänger:innen und Schriftsteller, deren Auswahl vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht, werden auf grossen Text- und Bildtafeln zitiert oder kommen in Video-Interviews selbst zu Wort.
Teil dieser Setzung, die Wagners Antisemitismus als Ausgangspunkt der Rezeption nimmt, ist nicht zuletzt sein Pamphlet «Das Judenthum in der Musik», das gleich zu Beginn der Ausstellung einsehbar ist. Dieses gilt als zentrales Dokument, mit dem Wagner den Antisemitismus in kulturellen Kreisen salonfähig machte. Wagner veröffentlichte das Pamphlet zunächst 1850 unter dem Pseudonym K. Freigedank und 1869 als erweiterte Broschüre. Diese besteht aus gut sechzig Seiten voller Abwertungen («Der Jude, der an sich unfähig ist, […] sich uns künstlerisch kundzugeben») und Verschwörungsfantasien («er herrscht, und wird so lange herrschen, als das Geld die Macht bleibt»). Am Ende stellt Wagner die Frage, ob «der Verfall unsrer Cultur», den er auf den jüdischen Einfluss zurückführt, «durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden fremden Elements aufgehalten werden könne».
Neben einer Weltanschauung, die das Gedankengut des noch bevorstehenden Nazismus vorwegnimmt, enthält das Pamphlet auch persönliche Angriffe gegen die Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und Giacomo Meyerbeer oder den Schriftsteller Heinrich Heine.
Das Thema bleibt «ambivalent»
Wie also «wirkte und wirkt Wagner auf Jüd:innen»? Giacomo Meyerbeer und Heinrich Heine reagierten nicht auf die Hetzschrift. Der Komponist Gustav Mahler, dem Wagner mit seinem antisemitischen Pamphlet nachhaltig schadete, wird in der Ausstellung wiederum als «Wagnerianer» bezeichnet, erkennt aber gleichzeitig in der Figur Mime im «Siegfried» die «leibhaftige, von Wagner gewollte Persiflage eines Juden». Hermann Levi, den Wagner 1882 aufgrund seiner jüdischen Herkunft als Dirigenten der Uraufführung des «Parsifal» in München ausschliessen wollte, schrieb 1882 in einem Brief: «Er [Wagner] ist der beste und edelste Mensch. […] Auch sein Kampf gegen das, was er ‹Judentum› in der Musik und in der modernen Literatur nennt, entspringt den edelsten Motiven.» Der Komponist Barrie Kosky sieht Wagner als bedeutenden Akteur, der die westliche Musik «revolutioniert» hat, aber gleichzeitig antisemitische Vorstellungen bewusst in seine Werke, in seine Erzählungen und Figuren eingearbeitet hat. «Das beste Gegenmittel zu Wagners Antisemitismus ist, dass die Musik von Jüd:innen gespielt wird», sagt Kosky im Video-Interview. Eva Engelmayer, eine weitere zeitgenössische Akteurin, unterscheidet in einem nächsten Interview zwischen Werk und Autor. «Ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, auch jüdische, welche diese Musik geniessen», sagt sie und fügt an: «Aber ich hoffe, dass der Betreffende sich stets bewusst ist über den antisemitischen Hintergrund und vielleicht auch weiss, wie sehr Wagner die wertvolle Musik jüdischer Komponisten heruntergemacht hat. So sehr, dass die Nazis sich später immer wieder auf ihn berufen haben, was mich als jüdische Frau ausserordentlich betroffen macht.»
Die Ausstellung zeichnet ein facettenreiches Bild und kommt zum Schluss: Ein eindeutiges Urteil lässt sich über Wagner, «[den] wohl umstrittenste[n] Komponist[en] des 19. Jahrhunderts», wie es in einem Wandtext heisst, nicht fällen. Das Thema sei und bleibe ambivalent.
Wagner als Vorzeichen
Obwohl die Ausstellung einen wichtigen Perspektivenwechsel vorschlägt, fällt das Fazit dann doch etwas mager aus. Dass die Haltungen gegenüber Wagner auch unter jüdischen Kunst- und Kulturschaffenden unterschiedlich sind, dürfte klar sein: «Die» jüdische Perspektive gibt es nicht. Doch täuscht Ambivalenz hier nicht eine Tiefe vor, wo eigentlich Unentschlossenheit herrscht? Produktiv wird es dann, wenn das Richard Wagner Museum die Position bezieht, dass Wagners Antisemitismus eben nicht mit Ambivalenz zu begegnen ist, sich Werk und Autor eben nicht voneinander trennen lassen. Denn dort, wo diese Trennung vollzogen wird, wird das normalisiert, was nicht normalisiert werden sollte; wird Wagners Antisemitismus zwar kontextualisiert, aber mit seinem grossartigen künstlerischen Schaffen gleich wieder entschuldigt.
Trotz der vergleichsweise kritischen Setzung der aktuellen Ausstellung ist noch immer ein Zögern spürbar: «Wagners Idyll» im unteren Stock bleibt unangetastet, die dort stattfindenden «Salonkonzerte» stellen nach wie vor den Schwerpunkt des Rahmenprogramms dar. Wer Kontext möchte, kann sich in den oberen Stock begeben.
Was die räumliche Aufteilung im Richard Wagner Museum suggeriert, gibt es nicht. Kunst entsteht nicht in einem Vakuum, sondern ist durchzogen von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und Wagner ist das beste Beispiel. In «Das Judenthum in der Musik» vermengte er künstlerische und politische Anliegen – und etablierte sie in kulturellen Kreisen. Gleichzeitig steht Wagner für eine historische Kontinuität, die im Verlauf des 20. Jahrhunderts zur tödlichen Politik wurde. Der Philosoph Theodor W. Adorno sieht Wagner als Vorzeichen des Nazismus, des Zweiten Weltkriegs, der Shoah. Wenn Wagner sich in «Das Judenthum in der Musik» also fragt, «[o]b der Verfall unsrer Cultur durch eine gewaltsame Auswerfung des zersetzenden fremden Elementes aufgehalten werden könne», und gleichzeitig zum Schluss kommt, dass dazu «Kräfte gehören müßten, deren Vorhandensein mir unbekannt ist» – wie könnte man da nicht an die noch bevorstehende NS-Gewaltherrschaft denken?
Diese Stelle wird in einem Wandtext zu Beginn der Ausstellung zitiert, mit der Anmerkung, dass Wagner damit «einen spekulativen Raum für den aufkeimenden politischen Antisemitismus» legitimierte, «der im 20. Jahrhundert in der Shoah kulminieren sollte». Obwohl eine historische Kontinuität festgestellt und erwähnt wird, dass Wagner von den Nationalsozialisten rezipiert, verehrt und etwa im Propagandafilm «Der ewige Jude» zitiert wurde, verfängt sich die Ausstellung erneut in Ambivalenzen, in vermeintliche «Vielschichtigkeit»: So sei etwa Wagners Antisemitismus vom NS-Regime «auffallend wenig rezipiert» worden, «zu widersprüchlich waren seine Äusserungen», «zu eng seine Kontakte zu Jüdinnen und Juden seiner Zeit».
«Tabu Wagner?»
Wenn solche Kontinuitäten anerkannt werden, geht es nicht darum, ein «Tabu Wagner» auszusprechen. Vielmehr geht es darum, als städtisch finanzierte Institution die Debatte nicht nur widerwillig an sich herantragen zu lassen, sondern sie zu initiieren, zu führen, verantwortungsvoll mitzugestalten. Und zum Beispiel zu fragen: Wenn Wagner im Sinne von Adorno ein Vorzeichen der NS-Gewaltherrschaft war – welche Schlüsse ziehen wir daraus? Wie setzt sich diese Kontinuität heute fort? Dies würde beinhalten, dass auch Wagner als Teil einer hegemonial gedachten (deutschen) Leitkultur, die nicht infrage gestellt werden möchte, eben infrage zu stellen ist. Zu fragen, wo die sogenannte Leitkultur auf Ausschluss basiert – und wo dieser noch heute wirkmächtig ist. Warum also nicht als Museum über die eigenen Ausstellungsräume hinausdenken, sich mutig und mitten im gesellschaftspolitischen Geschehen verorten?
In der Ausstellung wird die Absicht spürbar, ein facettenreiches Bild zu zeichnen. Doch Komplexität zuzulassen bedeutet nicht, Ambivalenz zur Ausrede zu machen, um keine Position beziehen zu müssen.