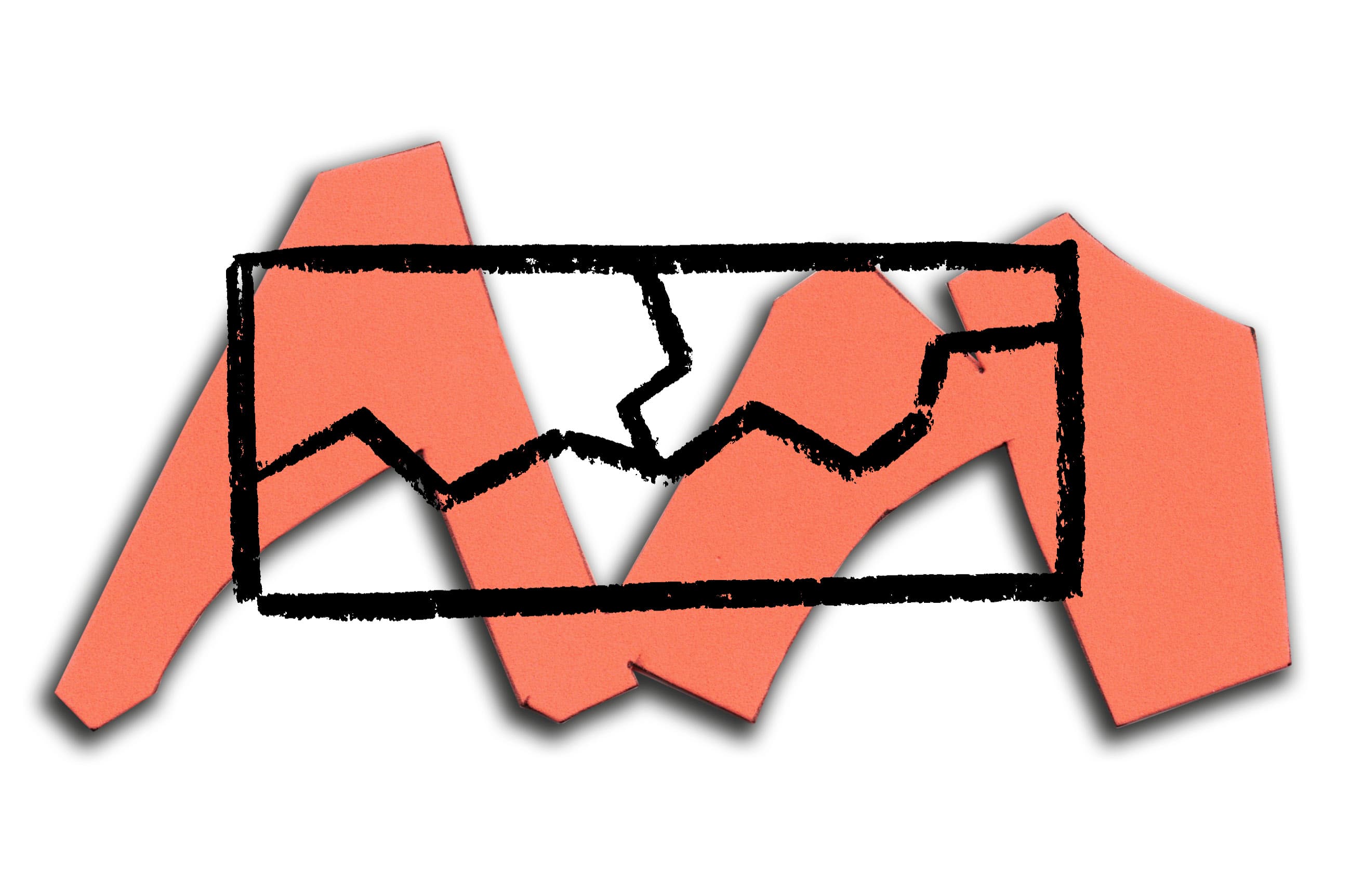01.05.24
Kunst
Wer bezahlt für dich?
Während des Zweiten Weltkriegs war Luzern eine wichtige Drehscheibe für NS-Raubkunst. Inwiefern hat das Kunstmuseum Luzern davon profitiert? Eine Antwort sucht man auch in der aktuellen Sammlungsausstellung vergebens.
Erich Keller (Text) und Alina Günter (Illustration)
Die Schweiz ist ein Land der Zahlen. Und eines der Museen. 1081 von ihnen hat das Bundesamt "ür Statistik ermittelt, 162 davon sind Kunstmuseen. All diese Institutionen bewahren über 77 Millionen Objekte auf. Doch auf welchen Wegen gelangen Kulturgüter eigentlich ins Museum? Die im Februar eröffnete Ausstellung «Woher kommst du?» im Kunstmuseum Luzern will dies anhand von Exponaten aus der eigenen Sammlung zeigen.
Auf der ästhetischen Ebene ist dies reizvoll: Was die Kunstgeschichte sonst streng in Epochen und Stile trennt, findet sich hier in einem kunterbunten Durcheinander versammelt. Etwa «Dwarf», der überdimensionierte Readymade-Zwerg des US-amerikanischen Künstlers Paul Thek von 1969 – düster grinst er in unmittelbarer Nähe der von Aristide Maillol um 1921 geschaffenen, anmutigen «Büste von Venus mit Fransen». Zwei Objekte, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch was die Wege betrifft, auf denen sie ins Depot des Kunstmuseums gelangt sind. So erfährt man, dass Theks Werk 1972 nach einer Ausstellung einfach liegengeblieben und später dem Museum geschenkt worden sei.
Ganz anders die Herkunft der Venus-Büste. Auch sie ein Geschenk, 1946 überreicht vom zwielichtigen Bankier Eduard von der Heydt, einem Nazi-Sympathisanten und Sammler aussereuropäischer Kunst. Noch zu Lebzeiten hatte er Teile seiner enormen Kollektion der Stadt Zürich überlassen, die damit das 1952 eröffnete Museum Rietberg bestückte – einen Knotenpunkt von Kunst- und Kulturobjekten aus kolonialem und nationalsozialistischem Kontext, wie es ihn in dieser brutalen Konsequenz kein zweites Mal in der Schweiz gibt.
Transparenz bei NS-Raubkunst
Bevor sich von der Heydt jener Venus-Büste bemächtigte, die heute in Luzern steht, hatte diese allerdings dem jüdisch-deutschen Sammler und Kunsthändler Alfred Flechtheim gehört. Im vergangenen Jahr wandten sich dessen Erb:innen ans Kunstmuseum mit der Bitte um Rückgabe. Seither wird in Luzern die Provenienz der Büste aufgearbeitet. Zu welchen Konsequenzen das "ührt, wird man hoffentlich bald erfahren.
Das Kunstmuseum informiert über diesen Fall vorbildlich. In längeren Textbeiträgen wird Transparenz über die kritische Provenienz geschaffen. Natürlich kann man sich fragen, welchen Zweck die Originaldokumente haben, die in den Vitrinen hinter den jeweiligen Werken liegen – Kaufbelege, Fotos, Korrespondenzen, Listen. Was sollen sie bezeugen? Ihr Aussagewert ist auch "ür Historiker:innen äusserst beschränkt, sagen sie doch isoliert, wie sie da sind, nichts über die geschichtlichen Zusammenhänge aus. Vielmehr verwandeln sich die Originalquellen in den Glaskästen auf eine irritierende Weise selbst in interpretationsoffene Kunstobjekte. Klüger wäre es doch, ihnen die relevante Forschungsliteratur beiseitezulegen, um so klarzumachen, dass Herkunftsfragen in komplexen, aufeinander aufbauenden Wissenszusammenhängen geklärt werden. Und sehr oft auch offenbleiben müssen, da wichtige Dokumente nicht mehr auffindbar sind.
Insgesamt wird in der Ausstellung offen über die Herkunft der ausgewählten Kunstobjekte mit NS-Vergangenheit informiert. Texttafeln an den Wänden klären zudem über die wesentlichen Begriffe im Zusammenhang mit Raubkunst auf und – auch das ist erfreulich –, sie verschweigen nicht, dass auch das sogenannte Fluchtgut darunter"ällt. Mit diesem sonderbaren Begriff hatten Historiker:innen der Bergier-Kommission bis anhin versucht, Notverkäufe von Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Verfolgung durch das Naziregime zu unterscheiden vom Kunstraub durch die NS-Behörden selbst; als ob nicht beide Formen des Eigentumsverlusts im antisemitischen Terror der Nazis ihren Ursprung hätten.
Immer noch verstecken sich Anwält:innen hinter der fragwürdigen Fluchtgut-Kategorie, um die heutigen Besitzer: innen gegen berechtigte Ansprüche von Nachkommen der Verfolgten zu verteidigen. Eigentlich aber ist der Begriff seit den Kontroversen um das Kunsthaus Zürich und die Sammlung Bührle implodiert. Das Kunstmuseum Luzern auf jeden Fall erklärt, dass die eigene Provenienzforschung die fragwürdige Unterscheidung zwischen Raubkunst und Fluchtgut nicht gelten lasse. Das mag wie eine Nebensächlichkeit klingen, ist aber ein wichtiger Schritt, die viel"ältigen Formen historischen Unrechts anzuerkennen und Verantwortung zu übernehmen. Denn eine solche Haltung signalisiert, dass man nicht länger um jeden Preis an Werken mit Verfolgungsgeschichte festhalten will. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie das Kunstmuseum reagiert, wenn möglicherweise weitere Forderungen nach Rückgabe von geraubtem Kulturgut eintreffen.
Fischer und das Kunstmuseum
Leider fehlen in der Ausstellung weitergehende Informationen zu NS-Raubkunst in der eigenen Sammlung. Wie viele Werke befinden sich insgesamt im Depot des Kunstmuseums, die infolge des Nationalsozialismus nach Luzern gelangt sind? Nach welchen Kriterien werden diese Provenienzen untersucht – fällt auch der Zeitraum nach 1945 darunter, die unmittelbare Nachkriegszeit also, als der internationale Handel mit Notverkäufen von Kulturgut über das Ende des Nationalsozialismus hinaus regelrecht aufblühte?
Geradezu atemberaubend ist, wie lückenhaft die Kunstgesellschaft Luzern – sie betreibt das Kunstmuseum – ihre eigene Geschichte schreibt. Auf der offiziellen Website wird die Zeit nach 1924, als Paul Hilber erst Präsident der Kunstgesellschaft, danach leitender Konservator des Museums war, grosszügig übergangen. Als hätten die Jahrzehnte dazwischen nicht existiert, setzt die Darstellung der eigenen Geschichte erst wieder in den 1970er-Jahren ein. Auch eine in hübsche Silberfolie gebundene Festschrift zum 200-jährigen Jubiläum der Luzerner Kunstgesellschaft von 2019 ist zwar reich bebildert, dafür aber fehlt jede historische Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Warum?
Immerhin ist Paul Hilber kein Unbekannter. 1941 etwa hatte er sich vehement dafür eingesetzt, die Gemäldesammlung des jüdischen Ägyptologen Ludwig Borchardt in der Schweiz zu verwerten. Borchardt war 1938 während der Flucht vor den Nazis in Paris gestorben, seine private Sammlung hatte er noch in der Schweiz deponieren können, als Museumsleihgaben sowie in Lagerhäusern und Zollfreilagern.
Hilber, damaliger Konservator des Kunstmuseums, machte sich bei den zuständigen Stellen dafür stark, die zurückgelassene Sammlung gewinnbringend aufzulösen. Das berichtete der Historiker Thomas Buomberger in seiner wegbereitenden Studie «Raubkunst – Kunstraub » schon 1998. Er zitiert Hilber, der in einem Brief an die Behörden empfiehlt, das, was von Borchardts Sammlung nicht in die hiesigen Museen passe, doch dem Luzerner Kunsthändler Theodor Fischer zu überlassen. Sicherlich könne dieser, schreibt Hilber in einem Brief, diese Reste «mit seinen lebhaften Beziehungen zu den deutschen Museen leicht wieder im Tauschwege gegen schweizerisch interessiertes Kunstgut nach Deutschland abstossen».
Die Behörden stimmten 1943 der Argumentation Hilbers zu und verfügten gegen Bedenken anderer Stimmen, dass Theodor Fischer 52 der 109 Gemälde der Sammlung Borchardt verkaufen dürfe.
Fischer, auch das ist längst bekannt, gilt als der wohl am tiefsten mit dem Nazi-Kunstraub verstrickte Kunsthändler und Galerist der Schweiz. Schon unmittelbar nach Kriegsende war er in den Fokus britischer und US-amerikanischer Kunstraubermittler geraten. Unter anderem hatte die Galerie Fischer im Luzerner Grand Hotel National im Juni 1939 eine international vielbeachtete Auktion von Werken durchgeführt, die in Deutschland als «Entartete Kunst» verfemt waren. Auftraggeber der Auktion war die NS-Regierung, an die Fischer, nach Abzug seiner Provision, den Erlös im Wert von rund einer halben Million Franken überwies. Die Gelder flossen wohl auch in die Kriegskasse der Nazis.
Der Standort Luzern gilt in der Forschung als wichtige Raubkunstdrehscheibe. Es läge also auf der Hand, die offensichtlich sehr engen und profitablen Verbindungen des Kunstmuseums zu Fischer und anderen in Luzern ansässigen Galerien, Kunsthändler:innen und Sammler:innen, die sich am NS-Kunstraub bereichert hatten, weiter aufzuhellen. Dies ist aber bislang nicht geschehen – und geschieht auch nicht in der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum. Das sollte dringend nachgeholt werden.
Der Standort Luzern gilt in der Forschung als eine wichtige Raubkunstdrehscheibe. Es läge also auf der Hand, die offensichtlich sehr engen und profitablen Verbindungen des Kunstmuseums zu Fischer und anderen in Luzern ansässigen Galerien, Kunsthändler:innen und Sammler:innen, die sich am NS-Kunstraub bereichert hatten, weiter aufzuhellen.
Knotenpunkte lokaler Eliten
Die wenigsten Werke dürften im Zusammenhang mit Kolonialismus oder Nationalsozialismus ins Kunstmuseum gelangt sein. So ist auch das Thema der Ausstellung «Woher kommst du?» weiter gefasst. Denn tatsächlich ist die Frage nach der Herkunft von Museumsobjekten auch noch aus anderen Gründen, die uns alle in der Gegenwart betreffen, interessant.
In dürren Textbeiträgen werden die wesentlichen Begriffe kurz, sehr kurz genannt: Kunstobjekte kommen in Museen durch Ankäufe, Schenkungen, Leihgaben oder Dauerleihgaben. Von zentraler Bedeutung sind Letztere, ohne sie kann heute kein Kunstmuseum mehr existieren. Zu hoch sind die Kunstmarktpreise für Werke namhafter Künstler:innen, wie es in einem der Texte steht. Will ein öffentliches Museum wachsen, kann es dies längst nicht mehr durch Ankäufe tun. In Luzern etwa stehen dafür jährlich 50 000 Franken zur Verfügung. Ein «äusserst bescheidener Beitrag», wie in der aktuellen Ausstellung beklagt wird.
Nur – warum überhaupt kommen kostspielige Sammlungen von Privaten in ein Museum? Schliesslich wandern die Werke nicht auf eigenen Füssen ins Depot. Immer noch aber scheint die Vorstellung zu gelten, die Institution Museum sei nichts anderes als eine Art von Schaukasten mit der Funktion, Kunst zu präsentieren und zu vermitteln.
Dabei zählen Kunstmuseen zu den einflussreichsten Akteuren auf dem globalen Kunstmarkt. Sie sind Knotenpunkte lokaler Eliten – reicher Stiftungen, einflussreicher Sammler:innen, politischer und ökonomischer Netzwerke, die ihre eigenen Interessen an Kunst verfolgen.
Die astronomischen Preise auf dem Kunstmarkt und das komplette Fehlen seiner nationalen wie internationalen Regulierung hat die Abhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Museen von privaten Stiftungen und reichen Sammler:innen zementiert.
Zwar verspricht der Ankündigungstext der Ausstellung im Kunstmuseum, Leihverträge zwischen Museum und reichen Stiftungen oder Privatpersonen zu erklären – doch davon ist nichts zu sehen. Kein Wunder, werden sie doch meist geheim gehalten. Wohl auch aus politischen Gründen: Wie soll eine Stadt oder ein Kanton erklären, dass jedes Jahr grosse Geldmengen aus der öffentlichen Hand (also aus Steuermitteln) und in Form von Subventionen in ein Kunstmuseum gepumpt werden – dass damit aber auch die Versicherungsprämien, Sicherheitskosten, Erforschung, Konservierung und Präsentation von Sammlungen mitfinanziert werden, die weiterhin Eigentum privater Stiftungen bleiben? Stiftungen, die dadurch als gemeinnützig gelten, da sie in öffentlich bezuschussten Museen ihre Kunst der Öffentlichkeit zugänglich machen – und deswegen steuerbefreit sind? Auf die Frage «Woher kommst du?» müsste also die nach dem «Wem gehörst du eigentlich – und wer bezahlt für dich?» folgen. Auch darüber würde man in der Ausstellung gerne mehr erfahren. Immerhin haben Stadt und Kanton Luzern im Jahr 2022 ihrem Kunstmuseum mit über 2 Millionen Franken unter die Arme gegriffen – bei einem Betriebsaufwand von 5,7 Millionen.
Wie viel Steuern private Stiftungen dadurch gespart haben, dass das Kunstmuseum ihre Werke zeigt, ist nicht bekannt.
Warum wird die so offensichtliche, unauflösliche Verbindung zwischen Reichtum und dem Bereitstellen von schöner Kunst eigentlich so beharrlich ausgeblendet, wenn über die Funktion von Museen gesprochen wird?
Museen fürs Standortmarketing
Ein letzter Aspekt, von dem die Ausstellung schweigt, betrifft den Zusammenhang zwischen dem Kunstmuseum, lokalen Eliten und der Luzerner Standortpolitik. Denn Kunstmuseen heizen mit den Objekten, die sie ausstellen und deren Sichtbarkeit sie dadurch steigern, nicht nur den Kunstmarkt weiter an. Auch die Macht und das Ansehen derer sollen sie befördern, die als private Mäzen:innen finanzielle Mittel in den Betrieb von Museen stecken, die wirtschaftlich nicht auf eigenen Beinen stehen könnten. In jedem Kunstmuseum findet man ihre Namen im Entrée prangen, noch bevor man einen Fuss in die Ausstellungsräume gesetzt hat. Warum wird die so offensichtliche, unauflösliche Verbindung zwischen Reichtum und dem Bereitstellen von schöner Kunst eigentlich so beharrlich ausgeblendet, wenn über die Funktion von Museen gesprochen wird?
Das meiste Geld, das den Betrieb von Kunstmuseen überhaupt erst ermöglicht, kommt wie erwähnt aber aus Steuererträgen. Museen und insbesondere Kunstmuseen gelten als entscheidende Faktoren im Standortmarketing, mit dem Städte sich im nationalen, aber auch globalen Wettbewerb zu behaupten suchen. Es sollen Unternehmen angelockt werden, mit ihren Brands, die mittlerweile in jeder grösseren Innenstadt das Strassenbild homogenisieren – und natürlich Tourist:innen. Kunstmuseen besetzen wichtige Stellen in diesen Prozessen. Sie generieren Aufmerksamkeit, bereichern das kulturelle Flair einer Stadt und funktionieren als unverzichtbares Glied in einer langen Wertschöpfungskette. Kunstmuseen wirken, selbstverständlich im Zusammenspiel mit anderen Institutionen, auch als urbane Gentrifizierungs- Hubs. Auch darüber müsste man sprechen, wenn man erklären will, wie die Werke ins Kunstmuseum gekommen sind – gerade in der Stadt Luzern, die sich dezidiert den Ansprüchen der Tourismus- und Luxusbranche angepasst hat.
Die Ausstellung «Woher kommst du? Wie Kunst in die Sammlung gelangte» ist bis Sonntag, 17. November 2024 im Kunstmuseum Luzern zu sehen.