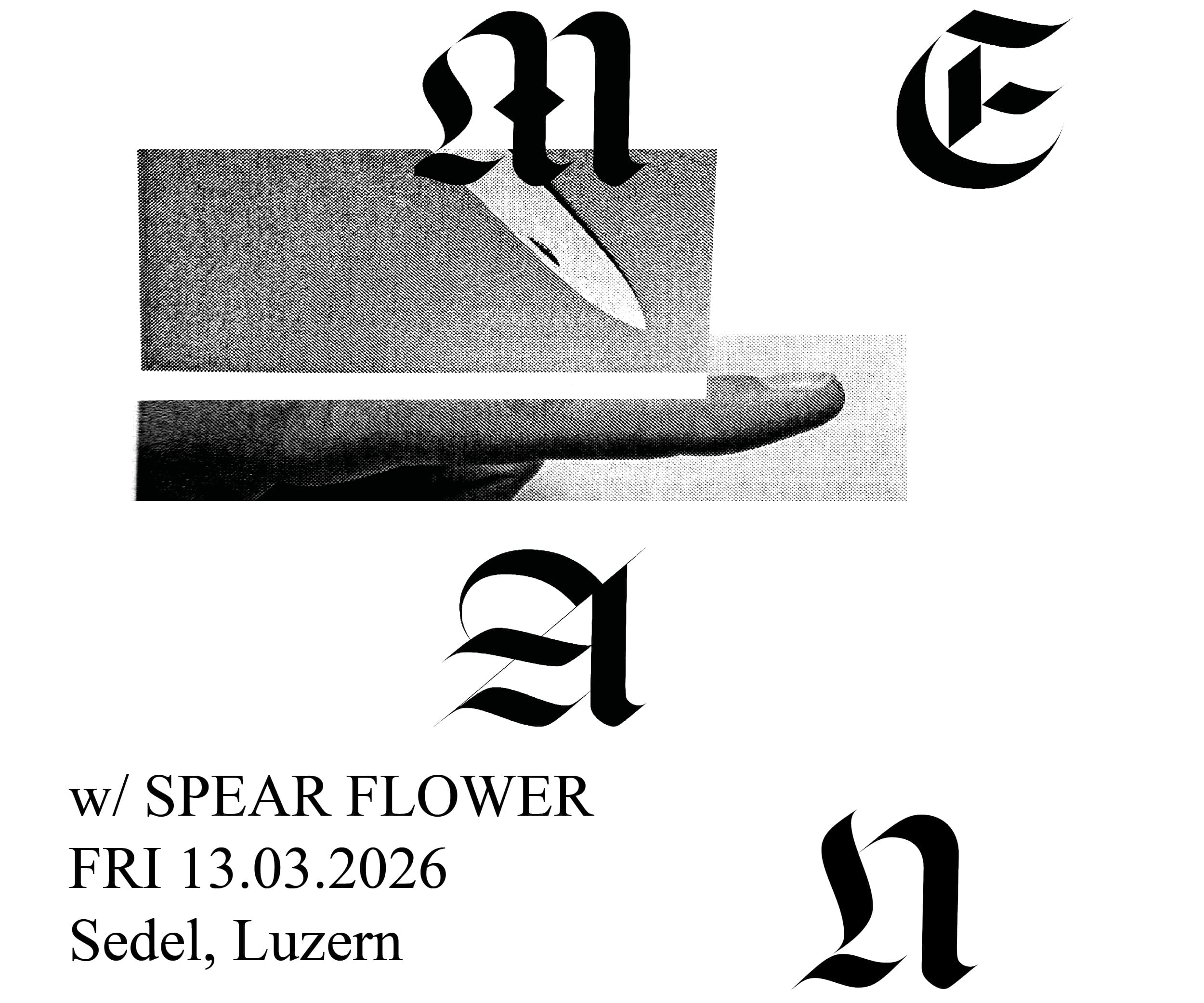03.11.25
Literatur
«Eine Grossmutter verschiebt etwas Kleines»
Der Roman «Grossmütter» von Melara Mvogdobo erzählt von zwei Frauen, von gesellschaftlich auferlegten Grenzen, von stillem Widerstand, der mit Hilfe ihrer Enkelinnen schliesslich laut wird. Nun wurde der Roman der Luzerner Autorin für den Schweizer Buchpreis nominiert.
Yael Inokai (Interview) und Anja Wicki (Illustration)
Melara Mvogdobo, «Grossmütter», dein zweiter Roman, wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert. Wie waren die letzten Wochen für dich?
Ich freue mich sehr über die Anerkennung, vor allem, weil sie die Sichtbarkeit des Buches erhöht und wieder eine Auflage gedruckt werden kann. Du weisst ja selber, das Schreiben ist manchmal ein Drang, fast ein Zwang; ich muss schreiben, ich werde schlaflos! Aber letztendlich gibt es auch eine gewisse Erwartung Künstler:innen gegenüber, dass sie alles um der Kunst willen machen. Von einem Klempner erwartet man das nicht. Dass der einfach stundenlang arbeitet und zufrieden damit ist. Insofern bin ich nüchtern und sage, sie ist toll, diese Nominierung, denn sie führt auch dazu, dass ich meinem Ziel näherkomme, vom Schreiben zu leben, ohne allzu grosse Existenzängste.
Du hast 2023 mit «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden», debütiert. Wie war dein Weg zur publizierten Autorin?
Ich fange mal mit einem ganz typischen Satz an: Ja, ich habe schon immer geschrieben, als Kind schon. Aber ich habe auch drei Söhne alleine grossgezogen und war hauptsächlich damit beschäftigt, Essen auf den Tisch zu bringen, zu schauen, dass wir unsere Rechnungen zahlen konnten. Kreative Sachen wurden nachts gemacht. Die ersten hundert Seiten meines Debüts habe ich vor zwanzig Jahren geschrieben, und das wurde zu einer Geschichte, bei der ich immer wieder Anlauf nehmen musste. «Mein fast veröffentlichtes Buch», so nannte ich es lange. Eine Lektorin hat sich erst jahrelang dafür eingesetzt, allerdings ohne Erfolg. Ich war mehrfach bei Wettbewerben in der engeren Auswahl, der Text lag in Verlagen auf dem Tisch, wo er dann drei zu zwei abgelehnt wurde. Ich habe mit der Zeit gemerkt, ein Buch zu schreiben ist nicht das Problem, das kann ich – aber ich muss erst mal eins veröffentlichen.
Dein Leben hat sich mit der Pandemie drastisch geändert. Du bist nach Andalusien ausgewandert, und nach all den Jahren erschien das Buch doch noch. Wie kam es dazu?
Ich bin sehr krank geworden während der Pandemie und leide immer noch unter Long Covid. Keine fünf Minuten konnte ich was machen, musste meinen Beruf als Lehrerin aufgeben. Da dachte ich, mein Gott, vielleicht kannst du jetzt sowieso nicht mehr schreiben. Das hat mir natürlich Angst gemacht. Aber es führte auch dazu, dass ich gesagt habe, jetzt schick dieses Manuskript einfach nochmal ein. Ich bekam dann schnell Antwort. Innerhalb eines Jahres haben wir das Buch überarbeitet; dreissig Minuten Bildschirm auf einmal, mehr ging nicht. Und dann erschien es tatsächlich.
Mit dem zweiten Buch bist du jetzt für den Schweizer Buchpreis nominiert und tourst gerade durch das Land. Wie empfindest du den Austausch mit dem Publikum?
Ich liebe Lesungen! Das, was es gesundheitlich für mich bedeutet, auf der Bühne zu stehen, nehme ich in Kauf. Ich bin seit fünf Jahren wegen Long Covid nicht mehr abends irgendwo essen gegangen. Ich kann mich nicht einfach so verabreden, auch Telefonate kosten mich wahnsinnig viel. Die Lesungen sind wie ein Bad in zwischenmenschlicher Interaktion, da kommen Fragen und Gedanken werden geteilt über Dinge, die mir, der Autorin, beim Schreiben gar nicht so bewusst waren. So entsteht eine Verbindung zwischen mir, meinem Schaffen und den Leuten, die es dann entgegennehmen. Da schliesst sich dann ein Kreis, wo sonst vielleicht eher losgelöste Teilchen schwirren.
«Ich habe mit der Zeit gemerkt, ein Buch zu schreiben ist nicht das Problem, das kann ich – aber ich muss erst mal eins veröffentlichen.»
Du hast an vielen verschiedenen Orten gelebt, aufgewachsen bist du in Luzern. Was verbindet dich mit der Stadt?
Ich habe dort die ersten achtundzwanzig Jahre meines Lebens verbracht. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann bin ich immer wieder berührt, auch von dieser Schönheit, und weil ich jede Ecke kenne und trotzdem eigentlich nichts mehr. Ich war eine begeisterte Fasnächtlerin, habe immer wahnsinnig viel investiert in Masken, schon im Dezember fing ich mit der Arbeit daran an. Da ist auch eine Wehmut in mir, diesen Februartagen gegenüber, dem Kreativsein, den Tagwachtmomenten. Wenn meine Kräfte es zulassen würden und ich irgendwie in der Nähe wäre, würde ich da wahrscheinlich immer noch mitmachen. Ich erinnere mich allerdings auch an die neunzig Tage Nebel im Winter ohne Unterbrechung. Diese Stimmung am See, die Geräusche der Taucherentchen, man denkt, mein Gott, kommt irgendwann diese Sonne mal wieder? Oder haben wir die jetzt abgeschafft?
In «Grossmütter» erzählen zwei Frauen aus ihrem Leben, eine Schweizerin und eine Kamerunerin. Ihre Leben sind sehr unterschiedlich, und doch empfand ich sie als verbunden in ihren Gefühlen, ihrem Ringen, in den Grenzen, die ihnen die Gesellschaft setzt.
Ich bin halb Kamerunerin, halb Schweizerin und das einzige Bindeglied zwischen diesen beiden Familien. Ich trete in zwei unterschiedliche Welten ein, die jeweils nichts voneinander wissen. Ich habe also die Sicht auf beide, und da ist oft dieser Eindruck, so weit entfernt voneinander sind die gar nicht. Die Beziehung zu meiner Schweizer Grossmutter war sehr eng und ich dachte häufig, mein Gott, dieses Leben und das von vielen Frauen in Kamerun, es unterscheidet sich nicht. Natürlich im Inhalt, aber nicht, was die Form anbelangt oder das Resultat davon. Der Unterschied ist vielleicht, dass die Schweizer:innen ein Überlegenheitsgefühl haben in ihrem Blick auf Afrika: Da muss ja alles furchtbar sein, die Frauen haben nichts zu sagen. Ich habe meine kamerunische weibliche Verwandtschaft allerdings immer als stärker empfunden, als rebellischer, schlagkräftiger. In der Schweiz gab es eher dieses Hinnehmen und Runterschlucken, mit den Dingen leben lernen und nicht mehr verlangen. Das habe ich hier jedenfalls gelernt. Also gelernt, ich war ehrlich gesagt nicht die beste Schülerin. Ich habe immer nachgefragt, mich ausgesetzt, schon ganz früh.
Jede Familiengeschichte ist auch ein Stück weit eine Geschichte der Gewalt. Meinst du das mit dem Aussetzen?
Ich bin jemand, der an die Verbindung über die Geschichten glaubt, die da überall in diesen Familien herumschwirren. Ich empfinde es immer als angenehmer, sie zu kennen. Und um sie zu kennen, muss man natürlich dabeibleiben und eintauchen, und das kann hart sein. Es gibt auch Momente, da bin ich gezwungen zu sagen, mehr brauche ich davon gerade nicht. Aber ich versuche diese Fäden nicht durchzuschneiden. Indem man sagt, das will ich nicht wissen oder das hat nichts mit mir zu tun, spaltet man Dinge von sich ab, die sehr wohl was mit einem zu tun haben.
Auf welche Geschichten bist du gestossen?
Auf die meiner Schweizer Urgrosstante beispielsweise, mit der ich sehr eng war. Sie wurde 1901 als jüngste Tochter der Familie geboren und durfte nicht heiraten. Kein Recht auf ein eigenes Leben, weil sie als jüngste Tochter eines Tages die Eltern pflegen sollte; gleichzeitig hatte sie die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, also ihr eigenes Geld zu verdienen. Bei solchen Traditionen denke ich dann wieder, wo ist da der Unterschied zu Kamerun? Oder meine Grossmutter, die tatsächlich ein uneheliches Kind hatte. Wenn ich meine Leute in Kamerun anschaue, da haben viele Frauen Misshandlungen erlebt, aber die haben sich teilweise wirklich dafür gerächt, haben Geld abgezweigt, intrigiert, mit aller Kraft versucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wie gesagt, mir ist das immer sehr schwergefallen, dieses Hinnehmen.
Den Grossmüttern aus deinem Roman widerfährt teilweise massive Gewalt. Zwei Generationen später sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Gewalt schon ganz anders aus. Oder?
Woher kommen wir als Gesellschaft? Der Schweizer Blick ist oft losgelöst von den Generationen, die vor einem waren. Das ist alles nicht lange her. In der Generation meiner Mutter wurden Kinder in der Schule und zu Hause noch geprügelt. Heute tut man so, als seien wir eine gewaltfreie Gesellschaft, und ich glaube, das stimmt nicht. Allein die ganzen Femizide … eine richtige Auseinandersetzung mit der Gewalt findet nicht statt.
Man blickt manchmal ganz schön streng auf die Generation der Grossmütter. Wie geht es dir damit?
Ich glaube, eine Generation kann vielleicht eine Aufgabe lösen, nicht hundert. Von heute aus wird dann gesagt: Da hat sie aber das Patriarchat unterstützt! Oft ist allerdings der Spielraum, den man tatsächlich hat, viel kleiner als der theoretische. Das wollte ich in meinem Buch auch darstellen. Eine Grossmutter verschiebt etwas Kleines, trifft eine Entscheidung, und das hat in der Generation ihrer Enkelin eine grosse Auswirkung. Eine Grossmutter entscheidet sich, ihre Kinder nicht beim Vater zu verpetzen oder einmal nur mit den Töchtern essen zu gehen und die Söhne zu Hause zu lassen. Das kann bei den Kindern schon als ein Akt der Grosszügigkeit oder der Gnade oder des Schutzes ankommen. Und so etwas bleibt. Man ist immer mit seiner Zeit und Epoche verbunden. Aber durch die scheinbar kleinen Dinge kann es eine Weiterentwicklung über die Generationen hinweg geben.