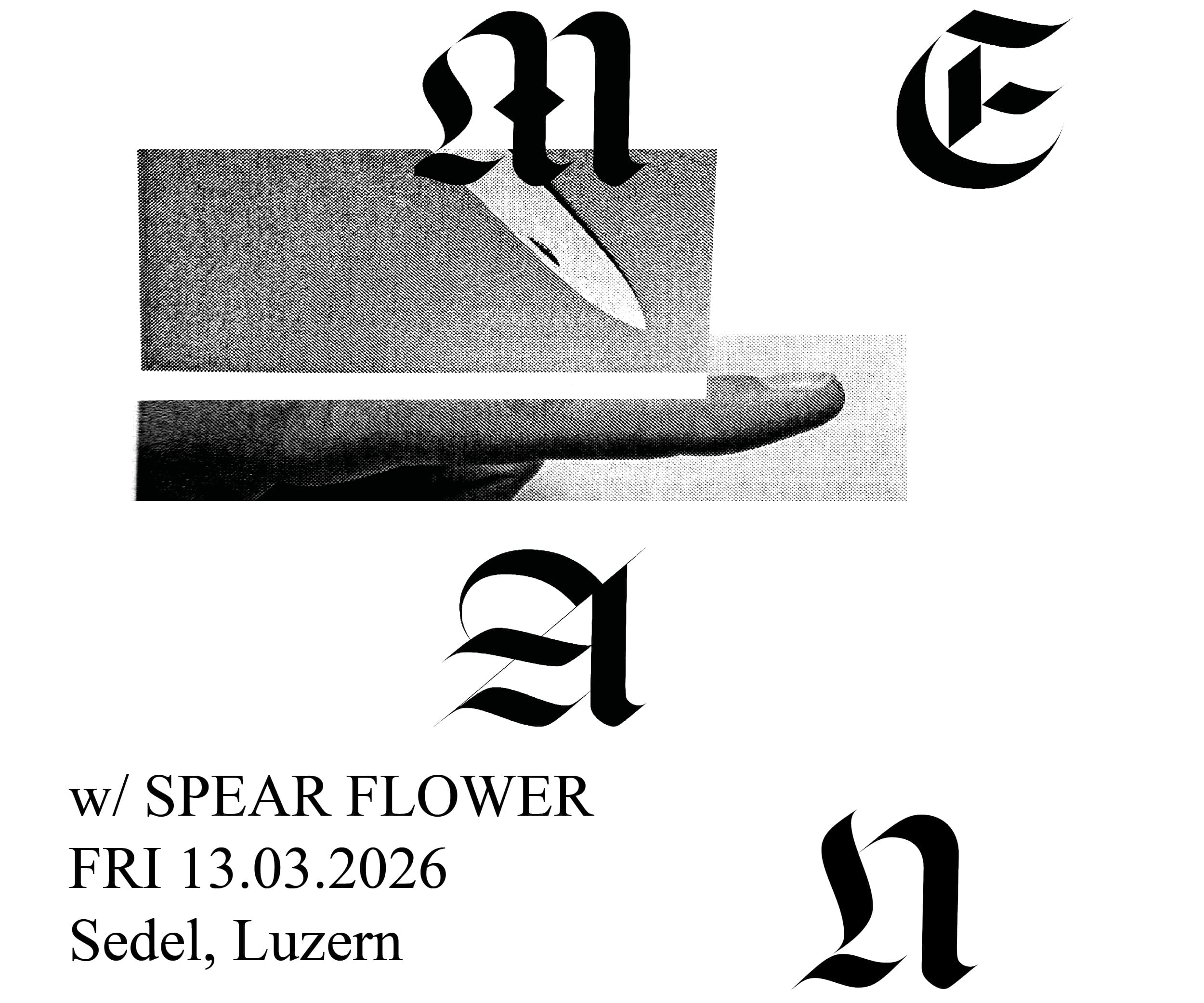08.01.25
Theater
Mehr als ein Haus
Luzern braucht ein neues Theater – und zwar schnell. Darin zumindest sind sich Theaterszene und Politik einig. Weshalb eine Debatte dennoch angebracht ist, darüber spricht Jonas Wydler mit den Theaterschaffenden Judith Rohrbach und Savino Caruso.
Jonas Wydler (Interview) und Kushtrim Memeti (Bilder)
Das Gebäude des Luzerner Theaters ist veraltet – es fehlt an Platz, es fehlt an der nötigen Infrastruktur. Ein grösseres Haus soll her. Der politische Prozess dazu läuft seit einigen Jahren. Mittlerweile ist der Standort geklärt, der Architekturwettbewerb abgeschlossen. Nun geht es ums Geld: Das Stadtparlament hat den Projektierungskredit von 14 Millionen Franken einstimmig gutgeheissen. Im Februar entscheidet erstmals auch die Stimmbevölkerung über den Kredit.
Wenig im Fokus der Öffentlichkeit stand die künftige Nutzung des Hauses. Ein Betriebskonzept liegt vor. Kritik daran kommt von einer Gruppe Musik- und Theaterschaffender, die in einem offenen Brief einen neuen Kulturkompromiss fordert. Im Zuge des KKL-Baus in den Neunzigern wurden Forderungen nach Investitionen in die Alternativkultur laut. Analog dazu wollen Akteur:innen aus verschiedenen Sparten heute neben mehr staatlichen Mitteln auch eine gesicherte Mitsprache im neuen Theater.
Wie könnte eine solche Mitsprache gestaltet sein? Und warum braucht es sie? Darüber sprachen wir mit zwei Theaterschaffenden: Savino Caruso ist Unterzeichner des offenen Briefes, Judith Rohrbach eine Kennerin der Theaterszene.
Wie nehmt ihr die Debatte über das neue Luzerner Theater seit dem offenen Brief wahr?
Judith Rohrbach: Ich habe mich schon lange gewundert, dass bisher niemand einen Kulturkompromiss 2.0 forderte. Für mich war immer klar, dass man darüber reden muss: Wenn man die eine Institution stärkt, muss man sich fragen, was mit den anderen Playern passiert. Knapp vor der Abstimmung ist nun ein guter Moment, um den Diskussionsraum zu öffnen.
Savino Caruso: Ich finde es positiv, dass man jetzt auch in der alternativen Kulturszene über das neue Luzerner Theater spricht. Das Haus ist ein bürgerlicher Ort in einer linken Stadt. Mir wurde vorgeworfen, ich sei unsolidarisch, weil ich den Brief unterschrieben habe. Das weise ich zurück. Ich will niemandem etwas wegnehmen. Aber: Nur weil ich Theater mache, stehe ich dem Kreis von Personen, die das Luzerner Theater betreiben, nicht automatisch nahe.
Aber Möglichkeiten, sich einzubringen, gab es ja schon vorher.
SC: Es wurde viel geredet, das stimmt – aber konnten wir uns wirklich einbringen? Die jetzige kulturpolitische Diskussion geht weit über das Luzerner Theater hinaus. Dass die Forderungen erst jetzt kommen, hat damit zu tun, dass wir auf der einen Seite mächtige und angesehene Institutionen mit vielen Ressourcen haben und auf der anderen Seite zahlreiche Kulturschaffende, die zu viel arbeiten, wenig verdienen und wenig Zeit haben.
JR: In der Debatte dominierten bisher vor allem die Themen Architektur und Standort. Was aber nie passiert ist und jetzt eingefordert wird: dass man alle Szenen mit an den Tisch holt. Bis jetzt gab’s für den Interessenverband T. Theaterschaffen Schweiz in der Projektierungsgesellschaft lediglich einen Einsitz ohne Stimmrecht. Schauen Sie sich das Machtverhältnis an: Für eine einzelne Person ist es in so einem Gremium wahnsinnig schwierig, für eine ganze Szene einzustehen und die Stimme zu erheben. Ich finde die Forderung, wirklich mitreden zu wollen, sehr legitim. Und es geht ja nicht nur um die freie Theaterszene. Die ganze Alternativkultur und semiprofessionelle Szene muss mitgedacht werden. Wir stehen alle in Abhängigkeiten voneinander. Es ist leider so, dass es existenziell werden muss, bevor etwas in Bewegung kommt.
Die Forderungen – eine Nutzungsrechtskommission, ein neues Gremium, ein fixer Anteil am Betriebsbudget – kann man als Absage ans Intendantenmodell verstehen.
SC: Ich finde es unverständlich, dass man am Intendantenmodell festhält. Die Art und Weise, wie man Theater in diesem etablierten Haus produziert, wurde nie infrage gestellt. Das erstaunt mich doch sehr. Denn diese Form der Kulturmonarchie, in der eine Person das Programm vorgibt, ist für mich nicht mehr zeitgemäss.
JR: Es gibt unterschiedliche Intendantenmodelle. Die Frage ist, wie stark man dabei in alten, hierarchischen Strukturen denkt. Man kann auch mehr in die Breite denken und Intendanz als Funktion verstehen, die eine gewisse Verantwortung hat, sich aber künstlerisch nicht so stark einbringt, wie das heute der Fall ist.
Das neue Luzerner Theater wird drei Bühnen haben. Im Betriebskonzept steht: «Besonders das Kooperieren mit regionalen Kulturpartnern verspricht zukünftig eine breitere Nutzbarmachung der Ressourcen.» Ist das nicht eine Chance für die freie Szene?
JR: Ja, aber nur im Rahmen der gewöhnlichen Spielmöglichkeiten. Und abhängig von einer Finanzierung. Wieso wurde nicht zuerst eine Vision entworfen, in der das Künstlerische im Vordergrund steht?
SC: Wieso nicht das französische Modell mit Quartiertheatern? Anstelle eines grossen Saals im Zentrum baut man verteilt über den Kanton vier kleinere Bühnen und tourt mit den Stücken dahin. Es gäbe so viele andere Möglichkeiten … was ich sagen will: Ein Gremium wird dafür bezahlt, ein neues Haus zu denken. Und das Einzige, das den Mitgliedern in den Sinn kommt, ist das Gleiche wie bisher?
JR: Es liegt in der Natur der Sache, dass Arbeitsgruppen aus homogenen Interessen zusammengesetzt werden. Man will etwas schützen. Diese Mentalität ist ein grosses Problem. Wer in der Kultur tätig ist, weiss, wie schwierig es ist, überhaupt Gelder zu bekommen. Das erschwert Denkprozesse, die alles komplett in Frage stellen.
Im neuen Luzerner Theater stehen der freien Szene laut Modellplan 4 von 38 Produktionen pro Jahr zu. Zu wenig?
SC: Ich glaube, das Bedürfnis der freien Szene, im Stadttheater stattzufinden, ist unter den aktuellen Bedingungen gar nicht so gross. Vor allem, wenn man sich einfach einmietet. Wenn, dann in einer künstlerischen Kooperation.
JR: Der Trend in der Kulturförderung ist momentan, dass mehr getourt wird. Es soll weniger produziert, dafür mehr und nachhaltiger gespielt werden. Beim neuen Luzerner Theater will man das Gegenteil: ein Haus mit noch mehr Räumen, das ganzjährig bespielt werden soll. Ich frage mich, wie zeitgemäss das ist. Und wer aus der freien Szene will dort überhaupt spielen? Die Freien haben eigene Ästhetiken, ein eigenes Tempo und können kurzfristiger auf Aktualitäten reagieren. In einem so grossen Haus wirst du langfristig denken und anders produzieren müssen.
Gibt es Vorbilder von Häusern, die es anders machen?
SC: Ich war die letzten Jahre oft als Gast im Stadttheater von Lausanne, im Théâtre Vidy. Dieses sucht sich seine Leute für Produktionen aus der freien Szene zusammen. In der Romandie gibt es für Theater und Performance keine Ensembles, nur freie Gruppen, die auch in den grossen, subventionierten Häusern die Inhalte produzieren. In Frankreich gibt es sogar über 300 staatlich finanzierte Compagnies. Der Staat investiert direkt in die Ideenfindung der Gruppen. Die Unterscheidung zwischen der etablierten, institutionellen Produktionsweise auf der einen und der freien Szene auf der anderen Seite gibt es so vor allem im deutschsprachigen Raum.
JR: In der Westschweiz hast du sechs, sieben Häuser, in denen du mit einer freien Produktion auftreten kannst. Die Diversität bei den künstlerischen Ansätzen ist dort viel grösser. Wenn man den ganzen Planungsprozess des neuen Luzerner Theaters zurückverfolgt, waren diverse Perspektiven und Interessen quasi nicht vorhanden – man blieb unter seinesgleichen.
SC: Das Publikum der freien Szene ist jünger und diverser. Luzern wird in Zukunft mehr Einwohner:innen haben, aber ob die ins Luzerner Theater gehen? Leute, die keine klassische Kulturerziehung hatten, werden nicht automatisch ins neue Haus gehen.
Aber es besucht ja nicht nur ein altes, gutbürgerliches Publikum das Stadttheater.
JR: Für jemanden, der nicht in einem kulturellen Umfeld aufgewachsen ist, ist die Eintrittsschwelle immer noch hoch. Da liegen das Neubad oder der Südpol näher.
SC: Diese Schwelle kann man nicht komplett abbauen – aber ich glaube, mit dem jetzigen Projekt versucht man das nicht mal. Dafür bräuchte es einen Willen und ein Umdenken.
Wieso hat die freie Szene in Luzern nicht genügend Aufmerksamkeit?
SC: Das Luzerner Theater bindet extrem viel Aufmerksamkeit und Ressourcen – die Grenzen haben sich vielleicht etwas aufgeweicht, aber ich bekomme immer noch zu hören: Das richtige Theater ist jenes, das im Luzerner Theater stattfindet. Dabei macht die freie Szene enorm viel für den Theaterplatz Schweiz, was Innovation, künstlerische Sprachen oder Inhalte anbelangt.
JR: Das war leider schon immer so: Von der freien Szene holen sich die grossen Häuser viele ihrer Ideen und Fachpersonen. Erst wenn man an einem Haus arbeitet, hat man es geschafft, sonst gilt man als weniger professionell. Das hat mit Status und Geld zu tun. Solange in der freien Szene so viel Gratisarbeit passiert, wird sich das auch nicht ändern.
Die Forderungen des offenen Briefs werden kaum alle erfüllt. Wie geht es weiter?
JR: Ich bin eng verbunden mit vielen Leuten am Luzerner Theater und möchte, dass es ein neues Theater gibt. Wenn der Prozess jetzt abbricht, wär’s ein Schuss ins eigene Bein. Ein Ja in der Abstimmung bedeutet erst mal, dass man weiterplanen kann. Ich hoffe, dass wir bei der Erarbeitung des definitiven Betriebskonzepts noch etwas herausverhandeln können: dass das Festhalten an einem Ensemblehaus mit Intendanz nochmals überdacht wird.
SC: Ich sehe das neue Luzerner Theater so: Rein vom Gebäude her – voll geil. Wieso nicht? Allerdings weiss ich noch nicht, wie die Einflussnahme bezüglich Betriebskonzept in den nächsten Jahren aussehen wird. Ich hoffe für die Zukunft aber, dass die Mitsprache zumindest politisch grösser wird. Dass im aktuell angedachten Intendantenmodell letztlich eine einzelne Person entscheidet, was künstlerisch passiert, finde ich in einer Demokratie das falsche Signal. Mich erstaunt diese Visionslosigkeit. Ein neues Luzerner Theater ist doch, wenn man es ernst meint, eine Investition in die Gesellschaft von morgen.